Theorie
und Geschichte der Parodie / Teil IV
von Theodor
Verweyen
Inhaltsverzeichnis:
I.
Einführung und Begründung des Vorlesungsgegenstandes
II.
Begriffsgeschichten und Begriff:
1. „Parodie”: Geschichte der Wortverwendung
II.
Begriffsgeschichten und Begriff:
2. „Kontrafaktur”: Terminologische
Erneuerung eines Begriffs der Literaturgeschichte
II.
Begriffsgeschichten und Begriff:
3. Terminologische Entscheidungen
zu „Parodie” und „Kontrafaktur”
II.
Begriffsgeschichten und Begriff:
4. Parodie und Urheberrecht
III.
Geschichte der literarischen Parodie:
Parodistische Paradigmen ‘vor unserer
Zeit‘
III.
Geschichte der literarischen Parodie:
Parodistische Paradigmen ‘vor unserer
Zeit‘ / 1. Die pseudo-homerische „Batrachomyomachia” als Beispiel hellenistischer
Epos-Parodie
III.
Geschichte der literarischen Parodie:
Parodistische Paradigmen ‘vor unserer
Zeit‘ / 2. Die Parodie im Mittelalter: am Beispiel parodistischer Verarbeitungen
in Heinrich Wittenwilers „Der Ring”
III.
Geschichte der literarischen Parodie:
Parodistische Paradigmen ‘vor unserer
Zeit‘ / 3. „Die Dunkelmännerbriefe” („Epistolae obscurorum virorum”):
ein Beispiel humanistischer Satire und Parodie
III.
Geschichte der literarischen Parodie:
Parodistische Paradigmen ‘vor unserer
Zeit‘ / 4. Parodie und Travestie im barocken Roman: Grimmelshausens „Simplicissimus
Teutsch”
IV.
Geschichte der neueren deutschen Parodie
IV.
Geschichte der neueren deutschen Parodie:
1. Friedrich Nicolai: „Eyn feyner
kleyner Almanach” - Parodie aus dem Geist der Aufklärung
IV.
Geschichte der neueren deutschen Parodie:
2. Die Parodie als Klassik-kritisches
Mittel: am Beispiel einer Schiller-Parodie A.W. Schlegels aus der Zeit
um 1800
IV.
Geschichte der neueren deutschen Parodie:
3. Parodistische Literaturkritik im
19. und 20. Jahrhundert: von Ludwig Eichrodt bis Eckhard Henscheid
Literaturhinweise
 Lenore
fuhr ums Morgenrot
Lenore
fuhr ums Morgenrot
Die Parodie-Sammlung der Erlanger
Liste.
3.
Parodistische Literaturkritik im 19. und 20. Jahrhundert: von Ludwig Eichrodt
bis Eckhard Henscheid
a) Vorbemerkungen: Versuch einer
Typologie parodierender Autoren
Der Versuch, die Vorlesung über
die literarische Parodie zu einem gewissen Abschluß zu bringen, ohne
damit zugleich ihren fragmentarischen Charakter übespielen zu wollen,
soll sich an einem Phänomen orientieren, das erst seit der Mitte des
19. Jahrhunderts aufkommt: daß Autoren ausschließlich als Parodisten
hervorgetreten sind oder doch nur als solche einen gewissen literaturgeschichtlichen
Rang gewonnen haben. Ich werde zunächst über dieses Phänomen
informieren und es dann auf übergreifende literarische Zusammenhänge
zu beziehen versuchen. Dazu skizziere ich grob eine Typologie parodistischer
Autoren. (Diese ist nicht zu verwechseln mit der Typologie parodierender
Verfahren nach der Art der „antithematischen Behandlung”, also der Übererfüllung
bzw. Untererfüllung! Die Typologie der antithematischen Behandlung
erfaßt Textphänomene, während die Typologie parodierender
Autoren Erscheinungen des Produzierens und der Produktionsentscheidung
ordnen soll.)
Erstens: Ein erster Typ ist
etwa durch Friedrich Nicolai repräsentiert. Ein Parodist (bzw. auch
travestierender Autor) dieser Art bezieht sich auf eine einzelne Vorlage
bzw. eine Gruppe von Vorlagen (Textklasse) und verarbeitet sie im Rahmen
der jeweiligen parodistischen bzw. travestierenden Zielsetzung (seiner
parodistischen bzw. travestierenden Intention) zu einem einzelnen Nachfolgetext.
Selbst wenn bei einem solchen Typ sogar ein erheblicher Teil der literarischen
Tätigkeit auf Parodie, Travestie, Cento usw. verwendet werden mag
– und das ist bei Nicolai zeitweilig durchaus der Fall –, erschöpft
sie sich darin jedoch nicht. Bedeutende Autoren dieses Typs sind etwa August
Wilhelm Schlegel, Johann Heinrich Voß, Friedrich Theodor Vischer,
Mynona (= Salomo Friedlaender), Erich Weinert, Bertolt Brecht (z. B. mit
Texten wie „Großer Dankchoral” oder „Kälbermarsch”), Peter Rühmkorf
(etwa mit den vier großen „Variationen” in seiner Gedichtsammlung
„Kunststücke” von 1962) und andere. Eine Reihe von Texten dieser Autoren
findet sich in unserem Reclam-Bändchen mit ausführlichen Kommentierungen
oder in der „Walpurga” mit Kurzkommentaren. Texte von A.W. Schlegel, Mynona,
Weinert, Brecht und Rühmkorf sind zudem in unserem „Parodie”- bzw.
„Kontrafaktur”-Buch teilweise mit ausführlichen Text- und auch wirkungsgeschichtlichen
Analysen versehen: so z. B. A. W. Schlegels Schiller-Parodie, Brechts „Großer
Dankchoral” und „Kälbermarsch” oder auch Rühmkorfs Eichendorff-Parodie.
Eigens hinweisen möchte ich hier auf Fr. Th. Vischers parodistische
und travestierende Fortsetzung von Goethes „Faust” (von 1862), aus der
ein charakteristischer Ausschnitt in die „Walpurga”-Anthologie (S. 136-143)
übernommen und der im „Parodie”-Buch (1979, S. 167-176) ein eigenes
Kapitel gewidmet worden ist. Vischers „Faust”-Parodie ist durch die Neuausgabe
von Fritz Martini in Reclams Universalbibliothek wieder bequem zugänglich1
und zur Anschaffung dringend empfohlen.
Zweitens: Ein zweiter Typ ist
im Hinblick auf solche Fälle zu unterscheiden, bei denen die Bezugnahme
auf Prätexte und deren antithematische Verarbeitung nur ein integrales
Element in einem übergreifenden und zugleich nicht-parodistischen
Textzusammenhang ist. Ich erinnere an E.T.A. Hoffmanns „Kater Murr” und
die integrierte „Lehrjahre”-Parodie und verweise zusätzlich etwa auf
das Beispiel in Günter Grass’ Roman „Hundejahre” (vgl. „Walpurga”,
S. 320f.), in die der Romancier eine die Zeitgenossen empörende Parodie
auf Martin Heideggers philosophisches Hauptwerk „Sein und Zeit” hineingearbeitet
hat. Erwin Rotermunds Terminus der „Partialparodie” liegt hier nahe. Ergänzend
möchte ich hinzufügen, daß Joris Duytschaever in einem
gelungenen Artikel über Döblins Aischylos-Rezeption die Orest-Parodie
und ihre Funktion in „Berlin Alexanderplatz” analysiert hat. Döblin,
um 1900 Student der Medizin in Berlin, dürfte zu seiner Lektüre
der Aischylos-Orestie durch Seminare des berühmtesten Altphilologen
der Wilhelminischen Ära, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf (1848-1931),
angeregt worden sein.2
Gelesen hat Döblin Aischylos (u. a. die verarbeiteten Tragödien
„Eumeniden” und „Agamemnon”) höchstwahrscheinlich in der bei Reclam
veröffentlichten Übersetzung von Hans von Wolzogen.3
Als ein herausragendes Beispiel dieses
Typs darf nicht zuletzt Bertolt Brecht mit seinem Stück „Die
heilige Johanna der Schlachthöfe” gelten. Darauf gehe ich paradigmatisch
etwas ein. Brechts Stück, 1959 durch Gustav Gründgens uraufgeführt,
ist schon in der Zeit nach 1928 entstanden und dann in mehreren Stufen
bis zum Druck in den „Gesammelten Werken” von 1938 überarbeitet worden.
Es ragt nach allgemeiner Einschätzung aus den Experimenten der „Lehrstück”-Periode
Brechts heraus, obwohl es nicht weniger als andere Stücke dieser Periode
ein „politisch kompromißlos engagiertes Stück” ist. Das zeigt
schon die Fabel, die ich hier kurzerhand nach Kindlers Literatur-Lexikon
vortrage:
„Von seinen New
Yorker Börsenfreunden beraten, verkauft Chicagos Fleischkönig
Mauler das Geschäft an seinen Kompagnon unter der Bedingung, den Bankrott
des gefährlichsten Konkurrenten herbeizuführen. Die ‚Schwarzen
Strohhüte’ der Heilsarmee unter ihrem Leutnant Johanna Dark können
das wachsende Elend der ausgesperrten Arbeiter nicht mit Suppen, Gesängen
und Reden aufhalten. Johanna wendet sich an Mauler um Hilfe. Er will ihr
beweisen, daß die Armen durch ihre Schlechtigkeit ihr Unglück
selbst verschulden, aber Johanna erkennt auf dem Schlachthof den Grund
für diese Schlechtigkeit: die Armut. Sie zieht mit den Schwarzen Strohhüten
in die Viehbörse, um Ordnung zu schaffen. Scheinbar gelingt ihr das,
aber Mauler hat den Markt nur gerettet, weil seine New Yorker Freunde ihm
inzwischen wieder den Fleischkauf empfohlen haben. Johanna, überall
wegen ihrer erfolgreichen Vermittlung gerühmt, begreift zu spät
, daß Maulers erneuerte Monopolstellung die Not in kurzer Zeit vergrößern
muß. Nun bietet sie den Arbeitslosen ihre rückhaltlose Unterstützung
an; doch als der Generalstreik mit dem Aufruf zur Gewalt vorbereitet wird,
verrät sie – Opfer falscher Informationen und Anhängerin der
Gewaltlosigkeit – ihre Verbündeten. Der Streik wird niedergeschlagen,
Sieger ist Mauler. Unter der Last ihrer Schuld bricht Johanna zusammen.
Um die Verbreitung ihrer Erfahrungen und Einsichten zu verhindern, beschließen
die Fleischhändler, die Sterbende, die den Unterdrückern so gelegen
kam, als Märtyrerin der Mildtätigkeit zu kanonisieren. Ihr Schrei
‚Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht, und / Es helfen nur Menschen,
wo Menschen sind’ geht unter in einem Furioso von Lobreden, Gesang und
Musik.”4
Die Fabel des Stückes läßt
natürlich noch wenig von dem erkennen, in welchem Verhältnis
Stück-Text und Stück-Titel („Die heilige Johanna”) zueinander
stehen, und doch schon ahnen, daß hier ein – für die „Lehrstück”-Produktion
Brechts ungewöhnlicher - intertextueller Beziehungsreichtum vorliegt.
Dieser Beziehungsreichtum gewinnt dabei erst im Laufe der Genese des Stücks
und seiner Überarbeitungen einen solchen Rang, daß in ihm im
Sinne eines Aktes der Selbstreflexion „der ideologische Charakter des literarischen
Redens selbst”5zum
Thema wird:
„in der fortschreitenden
Arbeit am Stück wird nämlich” – so Uwe-K. Ketelsen – „der ursprüngliche
Stoff, die Börsenproblematik und das Heilsarmeethema, immer weiter
aufgezehrt und im Gegenlauf der Materialcharakter des poetischen Redens
selbst immer entschiedener ‚ausgestellt’”. In der zweiten Arbeitsstufe
wird die ursprüngliche ‚Johanna Farland’ zu einer ‚Johanna Dark’,
d. h. „die Zentralfigur tritt vor den Hintergrund einer literarischen Folie;
zugleich wird Prosa zu Blankversen umgearbeitet, dem Sprachmaß der
Shakespeareschen Könige und der Schillerschen Helden, und damit nicht
nur der literarische Charakter der Personen bewußt gemacht, sondern
vor allem die literarhistorische Tiefe hergestellt. Brecht treibt in der
dritten Phase [der Überarbeitung] diese Tendenz fort, indem er den
Bezug zur literarischen Tradition genauer anzeigt; der Rückbezug auf
Schillers ‚Jungfrau von Orleans’ und auf Goethes ‚Faust’ wird deutlicher
pointiert. Jetzt baut er das Finale als Parodie auf Schillers Stück
aus. Die Arbeit an der Druckfassung in den ‚Versuchen’ [von 1932] schließlich
geht nochmals in diese Richtung weiter und steigert das parodistische Moment
(das übrigens auch die Radioinszenierung 1932 in der ‚Berliner Funkstunde’
prägte)”.6
Brecht legt demnach nicht nur das Stück
„Happy End” von Elisabeth Hauptmann als Quelle zugrunde; er greift Shaw
und U. Sinclairs Chicago-Roman „The Jungle” („Der Sumpf”) von 1906 auf;
verarbeitet Schillers „Johanna”-Stück und den Schluß des „Faust
II” Goethes; er bezieht die Bibel mit ein, etwa im 10. Bild des Stücks,
das eine Überschrift hat, die ein bei Lukas 14,11 überliefertes
Jesus-Wort aufgreift: „Pierpont Mauler erniedrigt sich und wird erhöht”.
In dieser Szene wimmelt es überhaupt nur so von bibelparodistischen
Anspielungen, beispielsweise im Gespräch Maulers, der sich inkognito
unter die Bettler bei der Heilsarmee gemengt hat, mit den „Schwarzen Strohhüten”
(Bertolt Brecht, Die heilige Johanna, in: Gesammelte Werke, Bd. 2, Frankfurt
a.M. 1967, S. 762):
„Ich
kannte einen, den bat man
Um hundert Dollar.
Und er hatte an zehn Millionen.
Und kam und
gab nicht hundert Dollar, sondern warf
Die zehn Millionen
weg
Und gab sich
selbst.
Er nimmt
zwei von den Schwarzen Strohhüten und läßt sich mit ihnen
auf der Bußbank nieder.
Ich will bekennen.
Hier, Freunde,
kniete keiner, der
So niedrig war
wie ich.
DIE SCHWARZEN
STROHHÜTE
Verliert nicht
die Zuversicht!
Werdet nicht
kleingläubig!
Er kommt gewiß,
er nahet schon
Mit all seinem
Geld.”
Über die Bibel hinaus adaptiert
Brecht in der 10. Szene zudem Hölderlin, und zwar jenes Gedicht des
Klassikers, das als sog. „Schicksalslied Hyperions” zum vermeintlich unverlierbaren
Bestand bürgerlicher Bildungsgeschichte gehört (vgl. Echtermeyer/von
Wiese [Hrsg.], Deutsche Gedichte, Düsseldorf 1960, S. 323: Strophe
1-4):
Friedrich
Hölderlin
Hyperions
Schicksalslied
Ihr wandelt droben
im Licht
Auf weichem
Boden, selige Genien!
Glänzende
Götterlüfte
Rühren
euch leicht,
Wie die Finger
der Künstlerin
Heilige Saiten.
Schicksallos,
wie der schlafende
Säugling,
atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener
Knospe,
Blühet
ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen
Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.
Doch uns ist
gegeben,
Auf keiner Stätte
zu ruhn,
Es schwinden,
es fallen
Die leidenden
Menschen
Blindlings von
einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von
Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahrlang ins
Ungewisse hinab.
Da ich ein Knabe
war,
Rettet‘ ein
Gott mich oft
Vom Geschrei
und der Rute der Menschen,
Da spielt ich
sicher und gut
Mit den Blumen
des Hains,
Und die Lüftchen
des Himmels
Spielten mit
mir.
[...]
Dieses „Schicksalslied” verarbeitet
Brecht nun bezeichnenderweise in dem Bericht des Fleischfabrikanten Graham
über den „Hergang jener Schlacht”, die „Uns alle in den Abgrund stieß”
(GW 2, S. 767):
„Und
ächzend, wie befreit, in diesem Augenblick
Da kein Vertrag
mehr seinen Kauf erzwang
Setzte das Rindfleisch
sich ins Bodenlose.
Den Preisen
nämlich
War es gegeben,
von Notierung zu Notierung zu fallen
Wie Wasser von
Klippe zu Klippe geworfen
Tief ins Unendliche
hinab. Bei dreißig erst hielten sie.
Und so wurd,
Mauler, dir dein Vertrag wertlos.
Statt uns am
Hals zu halten, hast du uns erwürgt.
Was nützt‘s,
den toten Mann am Hals zu halten?”
Ketelsen, den ich schon zitierte, hat
vorgeschlagen, in der, hier nur angedeuteten, Vielfalt parodistischer Verarbeitungen
bestimmter literarischer Traditionen ein konstitutives Element im Bedeutungsaufbau
des Stückes zu sehen, und folgende Interpretation skizziert: Durch
die parodistische Bezugnahme auf bestimmte literarische Traditionen erhalte
„Die heilige Johanna der Schlachthöfe” den „Charakter einer Art Lehrstück,
in dem der (bürgerliche) Zuschauer auf der Bühne vorgespielt
bekommen soll, welche Funktion die klassich-idealistische Literatur und
die ihr gewidmete Institution Theater in den sozialen Auseinandersetzungen
der Klassen habe: die historische Situation zu verschleiern, das erkannte
Elend zu überhöhen und damit zu verbrämen, die politisch-gesellschaftliche
Kritik zu neutralisieren”.7Der
Deutungsvorschlag U.-K. Ketelsens wirkt am Ende etwas arg forciert, sucht
jedoch auch sichtbar zu machen, auf welchen Ebenen sich die sog. Praxis
des Klassenkampfes realisieren solle. Daß Brechts Stück dabei
erhebliche Probleme mit dem Verhältnis von Überbau-Kritik (etwa
in Form parodistischer Behandlung) und klassenkämpferischer Auseinandersetzung
mit den konkreten Formationen der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
bekommen mußte, hat Ketelsen jedenfalls auch umrissen.
Für unsere Fragestellung bot sich
Brechts Stück ohnehin als ein besonders wichtiges Beispiel an. Es
kann nicht zuletzt dazu dienen, gerade jetzt an einen großen Autor
der deutschen Literaturgeschichte zu erinnern, dessen literarische Programme
und Konzepte immer wieder und aufs neue Arten und Formen parodistischer
Kritik und Herabsetzung gewissermaßen als unumgänglich umfaßten.
Ähnliches gilt auch für die Theaterstücke Peter Rühmkorfs
aus der Zeit um 1970, die ziemlich deutlich in der Brechtschen Lehrstück-
und Parabeltradition stehen.
Drittens: Der dritte Typ in
dem skizzenhaften Entwurf einer Typologie parodierender Autoren bildet
sich im Unterschied zum ersten und zweiten Typ erst im Laufe des 19. Jahrhunderts
aus und umfaßt solche Autoren, die entweder ausschließlich
als Parodisten (bzw. travestierende Autoren) hervorgetreten sind oder nur
als solche den Prozeß der literarischen Selektion überstanden
haben. Bevor ich über diese typenbildende Reihe überblicksartig
informiere, möchte ich für die beiden Subtypen jeweils ein herausragendes
Beispiel geben.
Für den ersten Subtyp nenne ich
die Sammlung der Parodien von René Hermann Markowsky aus dem Jahre
1961. Über den Autor ist nichts bekannt, andere Arbeiten von ihm sind
nicht bekannt geworden. Seine Sammlung mit Parodien vom Minnesang bis Gottfried
Benn unter dem Obertitel „Was ich athme wird Moral” (Nürnberg 1961)
liegt wie ein Findling in der Literaturlandschaft der späten Adenauerzeit
da. In der 1964 erschienenen Anthologie „Lyrische Parodien vom Mittelalter
bis zur Gegenwart” von Erwin Rotermund ist sie noch nicht berücksichtigt,
der 1981 publizierten Darstellung über die literarische Parodie von
Winfried Freund ist sie regelrecht entgangen. Wie schon der Untertitel
anzeigt, handelt es sich bei der Sammlung Markowskys um ein komisch-kritisches
Pendant zur akademischen Literaturgeschichtsschreibung, das aus der Feder
eines hervorragenden Kenners der Literaturgeschichte stammen muß;
das können bereits die beiden Textbeispiele illustrieren, die wir
in die „Walpurga” übernommen haben: einerseits eine wirklich gelungene
Parodie auf das physikotheologische Dichtwerk Barthold Hinrich Brockes’,
andererseits eine Parodie auf Thomas Manns Prosa. Parodie fungiert hier
tatsächlich als komisch inszenierte und – darauf hebe ich ab – literaturgeschichtlich
immanente Kritik.
Eine gleicherweise singuläre Parodiensammlung,
das sei an dieser Stelle bereits miterwähnt, gibt es von Dieter Saupe
(geb. 1932). Auch diese Sammlung – übrigens Robert Neumann gewidmet
– blieb die einzige eines Autors, von dem ebenfalls nichts bekannt ist.
Ihr Titel lautet „Autorenbeschimpfung und andere Parodien”. Sie erschien
1972 in München (als dtv-Band Nr. 880). Aus ihr ging die Parodie auf
Luise Rinsers Erzählung „Die gläsernen Ringe” in unsere „Walpurga”-Anthologie
ein.
Für den zweiten Subtyp führe
ich als Beispiel die Sammlung der Parodien von Hanns von Gumppenberg an.
Über ihn heißt es in der einzigen nennenswerten Monographie
von Karl-Wilhelm Frhr. v. Wintzingerode-Knorr:
„Christian Morgenstern
wurde weiteren Kreisen nur durch seine Grotesken bekannt, der Romanschriftsteller
Robert Neumann nur durch seine Parodien. Gumppenberg erging es ebenso,
er wurde berühmt durch sein Parodienbuch ‚Das Teutsche Dichterross
in allen Gangarten vorgeritten von Hanns von Gumppenberg’”.8
Die Sammlung erschien in dritter Auflage
1901 in einem Münchner Verlag. Dabei stehen der literarische Tageserfolg
und der literaturgeschichtliche Rang ebenso wie die Rezeptionsgeschichte
des Parodienbuches in krassem Widerspruch zur eigenen Einschätzung
der Parodien durch Gumppenberg selber. Seine aus dem Nachlaß veröffentlichten
Lebenserinnerungen geben darüber und über die Genese des ungeahnten
Erfolgs köstlichen Aufschluß:
Während
Gumppenberg an seinem Weltanschauungsdrama „Die Hugenotten” arbeitete,
„(brachte) (d)er 26. August 1888 (...) das Fest der silbernen Hochzeit”
seiner Eltern. „Ich gab zum vergnüglichen Abschluß des Festmahls
eine Reihe toller Ulkgedichte zum Besten, Karikaturen, die sich ohne bestimmte
Vorbilder über sentimentale Lyrik ganz im allgemeinen lustig machten.
Ich entfesselte mit diesen, meinen ersten lyrischen Parodien, zumal man
von meiner Ernsthaftigkeit dergleichen am wenigsten erwartet hatte, stürmische
Heiterkeit”.9
Ein parodistisches ‚Naturtalent’ wird
sichtbar; aber Gumppenberg selber arbeitete weiter an Weltanschauungsdramen
mit Titeln wie „Messias”, gewann Kontakt zum Kreis der Münchner Zeitschrift
„Die Gesellschaft”, die die „literaturpäpstliche Stellung” Paul Heyses
in München angriff und „kraftvollen Kulturfortschritt” propagierte,
zumal „die besonderen Münchener Verhältnisse (...) dazu mit(wirkten),
drohten doch hier der Ultramontanismus und andere reaktionäre Gewalten
jede frischere und neuzeitliche Lebensregung zu ersticken”.10Der
„Sturm und Drang der literarischen Revolution”11um
1890 begann:
H. v. Gumppenberg:
Lebenserinnerungen, S. 156-160: „Im Dezember 1890 … in zwei feindliche
Lager”12
Ich empfehle die Lektüre dieser
Passagen aus Gumppenbergs „Lebenserinnerungen”, damit der Zusammenhang
zwischen literarischem Leben und parodistischer Verulkung anschaulich wird.
Parodie erweist sich dabei freilich nur als ein Teil dieses literarischen
Lebens – nach Einschätzung Gumppenbergs selbst nur als ein sehr harmloser
Teil desselben, wobei er ihre tatsächliche Wirkung wohl eher falsch
beurteilte. Daß sich im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte die Aktualität
der parodistischen Literaturkritik verloren und zu einem ‚reinen’ ästhetischen
Vergnügen verändert hat, liegt gewissermaßen in der ‚Natur’
der Sache und läßt sich kaum gegen ihre ursprüngliche Funktion
in Anspruch nehmen.
Die Qualität der Parodien selbst
wie ihr Rang gegenüber den ‚ernsten’ Produktionen haben Gumppenberg
literaturgeschichtlich überleben und erfolgreich bleiben lassen. Eine
solche Feststellung wird etwa durch die Tatsache erhärtet, daß
nicht eine einzige neuere Parodie-Anthologie – von Rotermund bis Verweyen/Witting
und Winfried Freund – Gumppenbergs Texte überging. In die „Walpurga”-Anthologie
sind beispielsweise eingegangen: eine Textklassenparodie auf Eichendorff
(S. 144 – eine Cento-Parodie übrigens), eine Stilparodie auf die Dichtung
Stefan Georges, insbesondere auf dessen „Algabal” (S. 223), die Einzeltextparodien
„Genesung” auf Arno Holz’ Gedicht „Du, I” (S. 227f.) und „Dank” auf ein
Gedicht des Holz-Epigonen Reinhard Piper (S. 229), eine Parodie auf Richard
Dehmels Dichtung (S. 246) sowie Stilparodien auf die üblichen Gedenkreden
aus Anlaß der Todestage Goethes und Schillers – komische Rollenprosa
eines Professor Dr. Immanuel Tiefbohrer über Goethes ‚Weder- Weder’
und Schillers ‚Noch-Noch’ (S. 262-273). Natürlich hätten wir
die hier ausgewählten Texte leicht gegen andere aus Gumppenbergs „Dichterroß”
eintauschen können. Erwin Rotermund beispielsweise gibt in seiner
Anthologie „Gegengesänge” von 1964 einer Heine-, Rilke- und Dauthendey-Parodie
sowie zwei George-Parodien den Vorzug und widmet in seiner für die
Parodie-Forschung bahnbrechenden Dissertation von 1963 Gumppenbergs Eichendorff-Parodie
„Abendlied” eine eigene Analyse.13Und
so ließe sich gut eine kleine Rezeptionsgeschichte des Parodienwerkes
Gumppenbergs darstellen – eine Geschichte der Rezeptionen, die die ‚ernsten’
Arbeiten des Autors völlig dem literaturgeschichtlichen Vergessen
anheimfallen ließ.14Es
ist daher nicht verwunderlich, daß auch in jüngster Zeit vor
allem das Interesse an dem Parodisten Gumppenberg wach geblieben ist, wie
die 1999 erschienene, von Robert Seidel besorgte, feine Ausgabe des Parodien-Buches
in der 13. und 14. Auflage von 1929 belegt.
b) Die typenbildende Reihe parodierender
Kritiker der Literatur: in Einzelporträts
Diese Reihe beginnt allem Anschein
nach mit: Ludwig Eichrodt: *1827 in Durlach, †1892 in Lahr (Baden);
Jura-Studium in Heidelberg, hier mit Victor Scheffel Burschenschafter;
dann in Freiburg/Br.; seit 1871 Oberamtsrichter in Lahr; publizierte u.
a. unter dem Pseudonym Rudolf Rodt. Friedrich Theodor Vischer wurde einer
der Vorbildautoren für die parodistische Moritat Eichrodts. Charakteristisch
ist, was die Neue Deutsche Biographie von 1959 notiert:
„Das umfangreiche
humorvolle Gedicht ‚Wanderlust’ (Münchener Fliegende Blätter,
1849), das die damalige Auswanderungssucht parodiert [genauer müßte
es wohl heißen: satirisch behandelt und sich dazu in eigenwilliger
Form des ‚Mignonliedes’ bedient], begründete nicht nur den Ruhm Eichrodts
als eines humoristischen Dichters, sondern stempelt ihn dazu ab.”15
Nach den „Auserlesenen Gedichten von
Gottlieb Biedermaier, Schulmeister in Schwaben” (einer ungemein wirkungsvollen
Fiktion), nach den „Erzählungen des alten Schwartenmaier” (einer nicht
weniger wirkungsvollen Fiktion eines höchst poetischen Namens) und
nach den „Liedern des Buchbinders Horatius Treuherz” sagte Karl Gutzkow
voraus, daß Eichrodt schweren Stand mit Ernstem haben werde. Tatsächlich
fanden seine dramatischen Versuche, Libretti, Mundartgedichte und seine
ernste Lyrik, die besonders Goethe, Uhland, Heine und Scheffel epigonal
verpflichtet ist, kaum ein Echo. Dafür umso mehr neben den schon genannten
Textsammlungen das Parodienbuch „Gedichte in allerlei Humoren von Rudolf
Rodt” (Stuttgart 1853) und die Ergänzungen von 1869 unter dem Titel
„Biedermaiers Liederlust. Lyrische Karrikaturen”. Diese letztere Anthologie
vereinigt zwei unterschiedliche Parodiensammlungen: Deren erste bildet
der Zyklus „Lyrische Karikaturen”. Die Gedichte dieses Zyklus sind – ebenso
wie die des zweiten – im Laufe der 50er Jahre in den „Fliegenden Blättern”,
einem der meistgelesenen humoristischen Wochenblätter des 19. Jahrhunderts,
erschienen und haben in der Buchpublikation von 1869 ein kurzes „Vorwort”
erhalten, das mit der charakterisierenden Bemerkung beginnt:
„Karikatur ist
nicht sowohl Verzerrung als vielmehr lustige Übertreibung des Charakteristischen.”16
Übererfüllung ist demnach
das dominante Verfahren der parodistischen Manier Eichrodts. Das läßt
sich auch für einen großen Teil der „Gedichte in allerlei Humoren”
von 1853 sagen. Deren erste Abteilung mit dem Titel „Neuester deutscher
Parnaß” trägt bezeichnenderweise den anspielungsreichen Untertitel
„Eine Sammlung Manier-Gedichte”. Ist die Überfüllung einer „Manier”
das textkonstitutive Mittel Eichrodts, so bilden die 44 ‚lyrischen Karikaturen’
der späteren Sammlung von 1869 – mit Werner Kohlschmidt gesprochen
– „zusammengenommen eine Art Literaturrevue in parodistischer Form, die
von Schiller und Goethe bis zu Roquette und Scheffel reicht”.17Aus
dieser kritischen Literaturschau sind die parodistischen ‚Porträts’
von Friedrich Matthisson und Annette von Droste-Hülshoff für
die „Walpurga”-Anthologie (S. 97-99 bzw. S. 172f.) ausgewählt. – Neuerer
Zugang: Die „Gedichte in allerlei Humoren” von 1853 sind in neuerer Edition
nicht zugänglich; demgegenüber ist die Sammlung „Biedermeiers
Liederlust. Lyrische Karikaturen” (1869) als Band 7717 der Reclam-Reihe
durch Werner Kohlschmidt wieder greifbar gewesen.
Die nächste Stelle der typenbildenden
Reihe nimmt Fritz Mauthner ein: *1849 in Horitz bei Königgrätz
(Böhmen), † 1923 laut Killy-Lexikon in Konstanz18oder,
wie alle anderen Lexika angeben, in Meersburg/Bodensee; jedenfalls in Meersburg
begraben (übrigens unweit der Grabstätte Annette von Droste-Hülshoffs).
Der Sohn eines deutsch-jüdischen Webereibesitzers wuchs, wie er in
seinen „Erinnerungen” (München 1918) beklagte, ohne Muttersprache
und Religion auf. Als Jude in einem zweisprachigen Land mußte er
„die Leiden dreier Sprachen” – Deutsch, Tschechisch, Hebräisch – ertragen,
worin er später die Wurzel seiner sprachkritischen Haltung sah. Von
1869-1873 Studium der Rechtswissenschaften (ohne Abschluß) in Prag,
daneben Besuch philosophischer Lehrveranstaltungen, Hörer öffentlicher
Vorträge von Ernst Mach; Tätigkeit als Journalist und Schriftsteller
zunächst in Prag, 1876 in Berlin; hier Theaterkritiker am „Berliner
Tageblatt” und Redakteur am „Magazin für Literatur”; 1889 Mitbegründer
der Freien Deutschen Bühne, 1892 der Neuen Freien Volksbühne
(zusammen mit Bruno Wille und Gustav Landauer). Über Freiburg, wo
er 1905 tätig wurde, kam Mauthner 1909 nach Meersburg, wo er als freier
Schriftsteller lebte. Mauthners Veröffentlichungen umfassen Gedichte,
Romane, Novellen, Dramen, Kritiken und Essays. Von besonderer Bedeutung
sind seine (relativ späten) philosophischen Arbeiten. Deren Einfluß
erstreckt sich vor allem auf Dichter und nicht-akademische Philosophen
wie G. Landauer und Ludwig Wittgenstein sowie auf die sprachskeptische
Dichtung von Hugo von Hofmannsthal bis Samuel Beckett. Freundschaft verband
ihn mit Martin Buber und Gerhart Hauptmann. Grundlage des Einflusses Mauthners
ist seine Sprachkritik, über sie mag man sich mithilfe des Artikels
von Gottfried Gabriel in der „Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie”
informieren.19Literaturgeschichtlich
bedeutsam geblieben ist Mauthner trotz seines vielfältigen literarischen
Oeuvres allein durch die Wiederbelebung der kritischen, in der Regel satirischen
Literaturgattung ‚Totengespräche’ („Totengespräche”, 1906) und
nicht zuletzt dank seiner Parodien-Sammlung „Nach berühmten Mustern.
Parodistische Studien” (Stuttgart 1878; „Neue Folge” 1879). Sie erschien
als „Gesamtausgabe” unter gleichem Haupt- und Untertitel 1897 in der Deutschen
Verlagsanstalt. In ihrer „Einleitung” hebt Mauthner nicht nur den ungeahnten
Bucherfolg hervor: „Das erste Bändchen hat seit dem Jahre 1878 bis
jetzt 28 Auflagen erlebt, die ‚Neue Folge’ – 1879 leider in einem anderen
Verlage erschienen – 16 Auflagen”;20Fritz
Mauthner nimmt zugleich zu der irrigen Annahme der Literaturkritik Stellung,
seine Widmung im ersten Bändchen: „Meinen lieben Originalen in herzlicher
Verehrung zugeeignet”, sei ernstzunehmen. Der ironischen Zueignung entspricht
somit auch Mauthners Parodie-Auffassung:
„Parodie müsse
Kritik sein, oder sie dürfe gar nicht sein”.21
Interessant im Hinblick auf die eingangs
skizzierte Typologie ist zudem seine Bemerkung, es habe ihn damals verbittert,
„mit der Etikette eines Parodisten beklebt auf der Welt herumzulaufen.
Ich fand es damals abscheulich von dieser Welt, daß sie von meinen
blutigen Jugendgeschichten und Jugenddramen nichts wissen wollte, daß
die Herren Verleger von mir immer wieder Parodien und nichts als Parodien
verlangten”.22En
passant äußert er sich auch skeptisch in Bezug auf die Wirkung
von Parodien: „Ich habe mehr als einmal gelesen, daß meine Parodiensammlung
mit dazu beigetragen habe, den litterarischen Geschmack des deutschen Publikums
für eine neue Kunst vorzubereiten. Das war sehr nett von denen, die
es schrieben”.23Parodie
als Form der Kritik, und zwar als literarische Form der Literaturkritik,
bedient sich bevorzugt der Übererfüllung als Kunstgriff. Das
läßt sich Fall für Fall an den Beispielen studieren, die
wir in die „Walpurga”-Anthologie aufgenommen haben (S. 175-180: Parodie
auf Berthold Auerbachs Dorfgeschichten; S. 183-188: auf die Romanprosa
der „Gartenlaube”-Erfolgsautorin Eugenie Marlitt; S. 195-200: auf Richard
Wagners literarisches Werk; S. 204-207: auf Gustav Freytags Romanzyklus
„Die Ahnen”). Und Fall für Fall handelt es sich bei den parodierten
Autoren um Bestsellerautoren der unmittelbaren Gegenwart des Parodisten.
Das gilt auch im Hinblick auf das Werk „Philosophie des Unbewußten”
von Eduard von Hartmann, dessen Parodierung wir in der „Walpurga”-Anthologie
(S. 189-194) berücksichtigt haben, weil sich Mauthner auch in diesem
Fall kritisch an ein in der ‚philosophischen und halbphilosophischen Welt
geradezu populäres Werk’ heranmachte. – Zum Schluß illustrativ
eine Passage aus der Stilparodie auf die Stabreimerei Richard Wagners:
F. Mauthner:
Richard Wagner, in: Verweyen/Witting, „Walpurga”, S. 196:
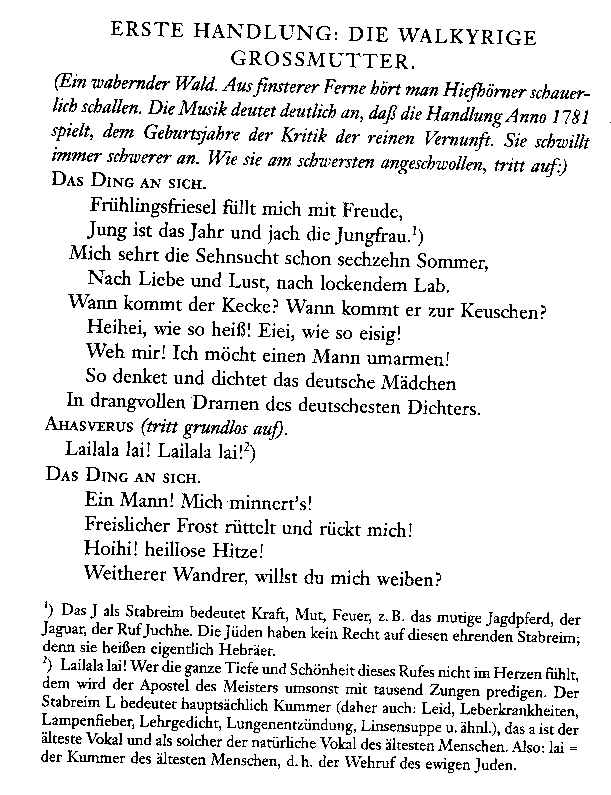
Neuerer Zugang: Er ist nicht gegeben,
es sei denn durch die Anthologie-Tradition und deren Selektionen. Die „Gesamtausgabe”
F. Mauthners ist nicht wieder aufgelegt worden.
In der typenbildenden Reihe folgt nun
Hanns (Theodor Karl Wilhelm) von Gumppenberg: *1866 in Landshut
(Niederbayern), † 1928 in München; Studium der Literatur in München,
dann freier Schriftsteller ebenda; Redakteur, Theaterkritiker der „Münchner
Neuesten Nachrichten”; Mitbegründer des Kabaretts „Die elf Scharfrichter”;
publizierte u. a. unter den Pseudonymen „Jodok” und „Prof. Tiefbohrer”.
Bezeichnend ist auch hier, was im 7. Band der NDB notiert steht: Gumppenbergs
„sprachliche Meisterschaft zeigen vor allem seine vollendeten Übersetzungen
nordischer und englischer Dichtungen […], seine Haupterfolge erzielte er
jedoch als Parodist”. So erfüllte sich seine Hoffnung auf eine Gesamtausgabe
seiner Werke nicht: es umfaßt beispielsweise 35 Dramen, von denen
nur 15 veröffentlicht sind. Demgegenüber war seiner Parodien-Sammlung
ein ganz anderer Erfolg beschieden. Der Hiat zwischen den ernsten Dichtungen
und den komisch-parodistischen Texten Gumppenbergs vergrößert
sich unterdessen noch mehr, wenn man weiß, daß der Autor über
das von kirchlicher Seite stark angegriffene Christusdrama „Der Messias”
(1890) zum Mystizismus und Spiritismus kam („Das dritte Testament” 1891,
„Der fünfte Prophet” 1895 usw.) und seine Weltanschauungsdramen als
„Gegenentwürfe zum materialistischen Weltbild des Naturalismus” und
als kritische Auseinandersetzungen mit der „modisch resignativen Grundstimmung
der Zeit” verstanden wissen wollte.24–
Gumppenbergs erfolgreiche Parodien-Sammlung trägt in der dritten Auflage
den Titel „Das Teutsche Dichterross in allen Gangarten vorgeritten von
Hanns von Gumppenberg. Dritte Auflage” (München 1901).25Die
Vorstufen zu dieser als dritte Auflage bezeichneten Sammlung sind nicht
ganz klar. Bei der vermeintlich 1. Auflage könnte es sich um die sog.
„Deutsche Lyrik von gestern (Parodien)” von 1888 handeln – also um das
bei der schon geschilderten Familienfeier eingestreute literaturkritische
Intermezzo. Die sog. 2. Auflage ist demgegenüber nachweislich im Druck
erschienen (und zudem in ganz wenigen Exemplaren noch erhalten): und zwar
in den „Münchener Flugschriften” 1891 als Nr. 3 unter dem Titel „Deutsche
Lyrik von gestern. Vortrag, gehalten am ersten öffentlichen Abend
der Gesellschaft für modernes Leben von Hanns von Gumppenberg”.26Wie
immer indes die nicht leicht durchschaubare Genese aussehen mag, gewiß
ist, daß erst die buchmäßige und erheblich erweiterte
Ausgabe der Parodien von 1901 (die sog. 3. Auflage) rezeptionsgeschichtlich
besonders bedeutsam geworden ist. Ihre Texte galten von Anfang an als Zeugnisse
einer – vom Verfahren der Übererfüllung bestimmten – brillanten
Behandlung des Charakteristischen der Vorlagen. Dafür wenigstens ein
illustratives, häufig angeführtes Beispiel (in: Verweyen/Witting,
Walpurga, S. 223):
Hanns von
Gumppenberg
american
bar
ein ruhgelaß
schrägab dem rädertreiben
da müden
seelen in gedämpfter stille
sich mälich
wieder ebnet sinn und wille
im schimmerglast
der zarten kräuselscheiben
umschmiegt von
feingebräunter holzbeschalung
bleichhell getönt
verwölben sich die wände
und friedlich
labt den blick verstreute spende
der dämmerkunst
in altersdunkler malung
der fliese mattes
rot wer könnt es singen
die schneegedecke
die willkommen sagen
der schlummerlehnen
schmeichelndes behagen
der silbernen
geräte leises klingen?
vielleicht doch
lieber wink ich mit den augen
dem kellner
in der milden weißen bluse
zum wohle meiner
nervenschwachen muse
blaßkühlen
saft durch hohles stroh zu saugen
nach stefan george
Neuerer Zugang: Es dürfte bezeichnend
sein, daß der Zugang zum „Dichterroß” gewahrt blieb; erinnert
sei hier an die dtv-Ausgabe von 1971 mit Armin Eichholz als Herausgeber
und mit der biographischen Skizze des Autors von Josef Hofmiller aus dem
Jahre 1929, zudem sei aufmerksam gemacht auf die Ausgabe von Robert Seidel
aus dem Jahre 1999.27
Im folgenden ist eine ganze Gruppe
von Autoren in der – typologisch organisierten – Reihe hervorzuheben: Autoren
der Zwanziger Jahre und der Zeit unmittelbar vor der faschistischen Wende.
Darunter sind:
Hans Heinrich von Twardowski:
*5.5. 1898 in Stettin, † 1958. Über den Autor ist außer den
dürftigen Angaben in „Kürschners Deutscher Literatur-Kalender
auf das Jahr 1922” (Berlin/Leipzig 1922, Sp. 896) nichts bekannt. Twardowski
hat, soweit sich bislang ermitteln ließ, nur eine Parodien-Sammlung
veröffentlicht, die nach einer ersten Ausgabe von 1918 unter dem Pseudonym
Paul Bernhardt in erheblich erweitertem Umfang in Berlin 1919 erschienen
ist: „Der Rasende Pegasus. Zweite stark vermehrte Ausgabe”. In einer den
Parodien vorgeschalteten Sammlung kleiner „Literarischer Porträts”
von Moriz Seeler ist der Parodist folgendermaßen charakterisiert: 28
„HANS
HEINRICH VON TWARDOWSKI – ein Gumppengebirge mit blonder lyrischer Seelenwiese.
Ein weißer Pierrot, der die Halbgötter mit einer Pfauenfeder
an der Nase kitzelt. Verklärung der Affektion.”
Die Charakteristik Twardowskis hier
als „Gumppengebirge” gewährt natürlich schon erste Aufschlüsse
über die von ihm bevorzugten Verfahren der Übererfüllung,
auch über die Tradition und Vorbildreihe, in der er gesehen wird.
Bestätigungen dafür lassen sich nicht allein im Generalmotto
finden, das der zweiten Ausgabe vorangestellt ist:
„Karrikatur ist
Verzerrung des Charakteristischen!”
Hinzu kommt eine famose Reaktion von
Peter Panter alias Kurt Tucholsky auf die parodistische Premiere Twardowskis,
und zwar in „Die Weltbühne” von 1918:29
„Der
junge Herr von Twardowski, wie er sich selber nennt, las in der Berliner
Sezession seine Parodien und Satiren. Es war ein Hauptspaß. Seit
Mauthner und Gumppenberg endlich wieder ein Parodist, und einer, der sich
eine ganz neue Nuance ausgedacht hat: den Verspotteten in dessen Manier
literarische Epigramme auf sich selbst sagen zu lassen. Manches war freilich
Bierulk, manches nur zwischen Kaiserallee und Kurfürstendamm verständlich
– aber die druckfähigen Stücke (und ihrer waren die Mehrzahl)
hatten Charme, Schlagkraft und eine seltene Dichtigkeit des Witzes. Von
Meyrink: „die Metaphysik der Hintertreppe”; von Paul Ernst: „Bei allem
schuldigen Respekt – es fehlt eine halbe Flasche Sekt.” Ja, er hat sogar
Selbstironie, diesen raren Artikel.”
Und in der Rezension des „Rasenden
Pegasus” von 1920 lautet die nochmals zugespitzte Charakteristik des parodistischen
Verfahrens so:30
„Die Parodien
Twardowskis, die zum großen Teil zuerst in der Weltbühne
erschienen sind, liegen jetzt gesammelt vor. (Der rasende Pegasus,
im Verlag von Axel Juncker zu Berlin.)
[...]
Seit Gumppenbergs
Teutschem
Tichterroß – vom alten Mauthner zu schweigen – ist das wieder
die erste brauchbare deutsche Parodiensammlung.
[...]
Twardowski macht
das so: er nimmt erstens das Kostüm des zu Parodierenden an, seine
Gestalt, seine Art, zu sprechen, und vor allem die, zu schweigen – und
wenn er das alles mit täuschenden Gesten vorgemacht hat, läßt
er den unglückllichen Tichter auch noch eine kleine Frechheit über
sich selber sagen. Es sind also keine reinen Parodien: sondern die guten
Stücke sind alle sehr witzige kleine Literaturessays kritischen Inhalts,
vorgetragen im Ton der verulkten Poeten.
[...]
Ich will euch
was sagen: bin ich vielleicht ein Fremdenführer? Lest das Buch selber!”
Neuerer Zugang: Nun, ich würde
Tucholskys Empfehlung ja gerne weitergeben. Aber es gibt leider keine Neuausgabe.
So müssen Sie sich mit dem bescheiden, was Sie von Twardowski in den
Anthologien finden, beispielsweise in der „Walpurga”-Anthologie S. 283ff.:
lauter Parodien auf Zeitgenossen des Autors, glänzende zumal, oder
in dem Reclam-Bändchen „Lyrik-Parodien” S. 112ff.: u. a. mit einer
Parodie auf August Stramm, den „Stoßvogel mit ekstatischem Gewürge”,
oder auf Hugo von Hofmannsthals Lyrik wie etwa die „Ballade des äußeren
Lebens” (in: Verweyen/Witting, Lyrik-Parodien, 1983, S. 112):
Hans Heinrich
von Twardowski
Monolog
eines jungen Mannes von vierzig Jahren
nach Hugo v.
Hofmannsthal
Das sind die
Tage, über denen allen
Flamingoblaues
Dämmern liegt.
– – Und hören
sehr perverse Orgeln schallen
Und Traueraffen
aus den Bäumen fallen
Und sind sehr
satt.
Und sind sehr
matt und alt.
Und tragen uns
mit kränklichen Gebärden
Und wissen,
daß wir waren, was wir werden.
Und es ist gut.
Und schreiben
öfter matte Operntexte.
Und zählen
still vom ersten bis ins sechste.
Und sagen: „Wien”.
Und sind noch
immer wie vor zwanzig Jahren.
Und wissen,
daß wir werden, was wir waren.
Und wedeln sanft.
Und wandeln
in der guten Abendröte.
Und spielen
gern und sehr den alten Goethe.
Und sind sehr
fein.
Und schreiben
edle Auf- und Niedersätze.
Und stellen
uns auf sehr belebte Plätze.
Und denken nichts.
Und haben einen
sehr gepflegten Stil.
Und nicken mit
dem Kopfe ganz und viel.
Und wirken sehr
ornamental.
Und sind in
dieser Welt wie in der Fremde.
Und tragen in
der Nacht ein seidnes Hemde.
Und werden nächstens
wohl katholisch werden.
Noch vor Robert Neumann ist zumindest
zu erwähnen Hans Reimann: *1889 in Leipzig, † 1969 in Schmalenbeck
bei Hamburg. Seine Pseudonyme, unter denen er publizierte, lauten anspielungsfreudig
u. a. „Hans Heinrich” (gemeint ist Ewers), „Artur Sünder” (gemeint
ist der „Blut- und Boden”-Schreiber Artur Dinter), „Hanns Heinz Vampir”
(gemeint ist der Ewers)! Für unseren Problemzusammenhang interessant
ist allein seine Parodien-Sammlung „Von Karl May bis Max Pallenberg in
60 Minuten” (München 1923), aus der wir eine Stilparodie auf die Werke
Gustav Meyrinks für die „Walpurga”-Anthologie (S. 301-304) ausgewählt
haben. – Neuerer Zugang: Trotz (schnell vergriffener) Neuausgabe in den
60er Jahren ist der Zugang erschwert, da seither eine weitere Auflage nicht
folgte.
Der nächste in der Typenreihe
ist Robert Neumann: *1897 in Wien, † 1975 in München (siehe:
Metzler Autoren Lexikon, hrsg. v. Bernd Lutz, Stuttgart 1986, S. 482).
Die letzte Aufzeichnung in seinem Tagebuch „Vielleicht das Heitere” von
1968 lautet: „Man braucht mehrere Identitäten.”
Diese Tagebuchnotiz verweist auch schon
auf das von Neumann bevorzugte Parodieverfahren der Übererfüllung.
Er selbst hat es auf eine zum Geflügelten Wort gewordene Formel gebracht,
und zwar in seinem Essay „Zur Ästhetik der Parodie” von 1927/28:
„Parodie ist
Karikatur mit den Mitteln des Karikierten.”31
Diese Formel greift, aufs Ganze gesehen,
zwar zu kurz, ist also nicht auf jedes parodistische Verfahren übertragbar
und leidet zudem unter der mangelnden Klärung des Begriffs „Karikatur”;
aber sie vermag dennoch seine Parodien zu charakterisieren, wenn man eben
das zeichnerische Verfahren der Überzeichnung in der bildenden Kunst
als Verfahren der Übererfüllung in der Literatur erkennt. Das
müßten im Grunde schon die in die „Walpurga” eingegangenen Texte
zeigen können – beispielsweise die Parodie „Godekes Knecht. Nach Hans
Leip” („Walpurga”, S. 315), der wir zudem an verschiedenen Stellen unserer
Monographie über die Parodie besondere Aufmerksamkeit angedeihen ließen.32Bezeichnend
ist etwa die Reaktion des parodierten Autors H. Leip (vgl. Verweyen/Witting:
Die Parodie, 1979, S. 77):
„Herr Neumann!
Was ich schon
immer über Sie gedacht habe, bestätigt sich: Sie sind ein kleiner
verkappter Oberlehrer! Sie fummeln so prächtig mit dem Zeigestock
umher, so richtig aschbeutelig. Immerhin sollte ich Ihnen womöglich
dankbar sein, daß Sie Ihre Nase überhaupt in ein paar Anfangsseiten
eines Buches von mir geklemmt haben. Achott, Parodieren ist leicht. Dafür
ist ja auch Ihr Roman ein recht bescheidener margarinehafter italienischer
Salat. Hans Leip.”
Diese Reaktion bestätigt auf ihre
Weise, ex negativo, die Anerkennung Robert Neumanns als eines Meisters
der Stilparodie, wie das folgende Beispiel zeigen kann (in: Verweyen/Witting,
Walpurga, S. 224):
Robert Neumann
Mutteranruf
nach Hugo von
Hofmannsthal
Und Kinder wachsen
auf mit großen Augen
Und wissen schon
von ihrem tiefsten Walten
Und wollen es
schon daumenhaft besaugen.
Und Mütter
gehn, und immer wieder halten
Und heben sie
die drohbereite Geste
Und stehn erstarrt
und drohn noch im Erkalten.
Und Dichter sind,
und ihre Anapäpste
Sind wie die
Neige tiefgesenkter Krüge
Und schmecken
schal wie trübe Hefereste.
Und wiegen sich
in ihrer samtnen Lüge
Und lieben Prunk,
ein wenig überplundert,
Und spreizen
sich in gestriger Genüge.
Und stehen bleich
im lärmenden Jahrhundert
Und nehmen dankbar
jegliche Beschau an.
Betroffen steht
die Zeit: es bellt verwundert
Ein Bologneserhündchen
einen Pfau an.
Neuerer Zugang: Neumanns Werk, vor
allem das parodistische, blieb bis heute durch viele Ausgaben zugänglich.
Besonders erwähnen möchte ich hier die Rowohlt-Bände „Parodien
1. Mit fremden Federn” (Reinbek b. Hamburg 1978) und „Parodien 2. Unter
falscher Flagge” (Reinbek b. Hamburg 1979).
Im selben Jahr, in dem die Fortsetzung
des Neumannschen Parodienwerks „Unter falscher Flagge” erschien – 1932
–, tat sich ein weiterer Autor mit gekonnten Parodien so hervor, daß
auch ihm später zeitweilig das Odium drohte, ‚nur’ Parodist zu sein:
Friedrich Torberg, eigentlich Friedrich Kantor-Berg, über den
es jetzt auch eine literarhistorische Untersuchung gibt:33*1908
in Wien, †1979 in Wien; Studium der Philosophie in Prag; 1938 Emigration
über die Schweiz in die USA; Rückkehr 1951 als amerikanischer
Staatsbürger nach Wien. Torberg ist ein ungemein fruchtbarer Autor
gewesen: als Romancier, Essayist, Feuilletonist, Novellist, Lyriker, Theaterkritiker,
Übersetzer; er hat, darin Karl Kraus folgend, alle Moden aufs heftigste
bekämpft, hat sich den Zorn der Thomas Mann-Leser ebenso zugezogen
wie den Zorn der Bert Brecht-Anhänger. Bezeichnenderweise trägt
der dritte Band seiner „Gesammelten Werke” den Titel „PPP – Pamphlete,
Parodien, Post Scripta”; dieser enthält u. a. auch die Parodien-Sammlung
von 1932 „Angewandte Lyrik von Klopstock bis Blubo. Eine Literaturgeschichte
in Beispielen”: sie ist vollständig in die „Walpurga”-Anthologie (S.
329-335) eingegangen. Sie bestätigt erneut die Dominanz der Methode
der Übererfüllung und Stilparodie, wie auch aus den wenigen poetologischen
Bemerkungen hervorgeht, die Torberg seiner Sammlung vorausgeschickt hat:34
„Ähnlich
wie der Begriff „Pamphlet”, unterliegt auch der Begriff „Parodie” mehreren
Deutungen, und zwar lauter unzulänglichen. Man kann über die
Parodie die verschiedensten falschen Meinungen hören. Häufig
wird sie mit bloßer Nachahmung verwechselt (womöglich mit „täuschender”),
häufig mit gutmütigem Spott, häufig (zumal in gebildeten
Kreisen) mit ihrem genauen Gegenteil, der Travestie, und fast immer mit
einer lediglich formalen Spielerei. Die einzige zulängliche – und
vorbildlich präzise – Definition dieser komplizierten Kunstform stammt
von Robert Neumann, ihrem unbestrittenen Meister, und lautet: 'Parodie
ist Karikatur mit den Mitteln des Karikierten.'”
Ein Beispiel aus der poetologisch derart
festgelegten „Literaturgeschichte” – die Parodie „Großstadtlyrik”
– ist in unserer Untersuchung über die Parodie von 1979 etwas näher
beschrieben worden.35Und
wie die Machart ‚Karikatur mit den Mitteln des Karikierten’ funktioniert,
wird etwa für den Hofmannsthal-Leser auf unmittelbare Weise anschaulich
in der „Hofmannsthal”-Parodie, in der Segmente der „Ballade des äußeren
Lebens” und des „Lebensliedes” komisch kombiniert sind (in: Verweyen/Witting,
Walpurga, S. 332.):
Friedrich
Torberg
Hofmannsthal
Und Dichter wachsen
auf und lesen vieles,
und sind wie
Lamm und Pfau, und sehr umragt
von der Bemühtheit
ihres eignen Stiles.
Und dennoch sagt
der viel, der „Trakl” sagt.
Neuerer Zugang: Torbergs Sammlung „PPP”
von 1964 hat 1976 eine Neuauflage erfahren und wurde in einer Auswahlausgabe
(dtv – Band 1622) 1981 wieder zugänglich gemacht.
Die große Lücke, die sich
nun nach 1932 in der typenbildenden Reihe parodistischer Literaturkritik
auftut, ist – wie sich leicht einsehen läßt – literaturextern
bedingt. Vereinzelte Parodien-Sammlungen setzen die Reihe erst in den späten
Vierzigern und frühen Fünfzigern fort:
etwa mit Armin
Eichholz
(*1914): „In Flagranti. Parodien” (München 1954);36Rolf
Schneider (*1932): „Aus zweiter Hand. Literarische Parodien” (Berlin-Ost
1958) ; Manfred Bieler (*1934): „Der Schuß auf die Kanzel oder Eigentum
ist Diebstahl” (Berlin-Ost 1958); Günter de Bruyn (*1926): „Maskeraden.
Parodien” (Halle a.d. Saale 1966). Diese Sammlungen und Autoren lassen
sich ergänzen durch: Wolfgang Buhl (*1925) mit den Parodien-Sammlungen
„Äpfel des Pegasus” (Berlin-West 1953) und „Pflaumen des Pegasus.
Neue Parodien” (München 1985)37sowie
Kurt Bartsch (*1937) mit „Die Hölderlinie – deutsch-deutsche Parodien”
(Berlin-West 1983), der schon 1968 mit „Zugluft – Gedichte, Sprüche,
Parodien” (erschienen Berlin-Ost) hervorgetreten war. Hinzu kommen noch
Karl Hoche (*1936) mit „Schreibmaschinentypen und andere Parodien” (München
1971, 21972) und „Das
Hoche Lied” (München 1976)38,
Klaus Döhmer mit „Leda & Variationen. 60 Studien über ein
Brockhausmotiv” (Trier 1979) sowie Eckhard Henscheid (*1941) zuletzt mit
Parodien wie „Herrmann Burrger” in seinem Buch „Frau Killermann greift
ein. Erzählungen und Bagatellen” (Zürich 1985):39aufgenommen
in die „Walpurga”-Anthologie (S. 440-444).
Im Hinblick auf diese Typik wäre
nun eine Reihe von Fragen interessant: Hat in ihr die Autorkritik Vorrang
vor der Rezeptionskritik? Gibt es in ihr eine Entwicklung von der autorkritisch
orientierten Parodie/Travestie zur rezeptionskritisch orientierten Parodie/Travestie?
Läßt sich diese eigene Typenreihe parodistischer/travestierender
Literaturkritik mit dem allgemeinen literarischen Prozeß in Beziehung
setzen, wie eben dieser im Zusammenhang mit der Frage nach der Gesetzlichkeit
neuerer ästhetischer Evolutionen: „Kunst entsteht aus Kunst und gegen
Kunst”, diskutiert wird? Für die Darstellung dieser und anderer Fragen
fehlt es leider noch an brauchbaren Vorarbeiten.
Im Titel des Teilkapitels bildet der
Name Eckhard Henscheids den Schlußpunkt, und dies durchaus nicht
bloß aus literaturregionalen Gründen. An zwei Stellen der „Walpurga”
(S. 418-422 und S. 440-444) ist er schon mit Parodien auf außer-literarische
Textsorten berücksichtigt. Und in der „Walpurga” ist er zudem vielleicht
mit dem Schlußstück repräsentiert – dann freilich anonym:
mit einer brillanten Parodie auf die Ankündigungen des Verlagsprogramms
des Suhrkamp Verlages („Walpurga”, S. 448-462). Für die Autorschaft
Henscheids gibt es ein interessantes, wenn nicht gar untrügliches
Indiz: Als Henscheid im 11. Jahrgang der „Titanic” die „Walpurga”-Anthologie
besprach, wartete er mit Kenntnissen auf, über die nur ein in die
‚Szene’ Eingeweihter verfügen kann; ich zitiere ihn aus der Spalte
„Humor-Kritik” in der „Titanic”:40
Hans Mentze (d.
i. Eckhard Henscheid):
„Walpurga,
die Taufrische Amme, Parodien und Travestien von Homer bis Handke. Herausgegeben
von Theodor Verweyen und Günter Witting”, Serie Piper. Rund 500
kundig gefüllte Seiten, mit denen man, beispielsweise, einen Goethe
ganz schön auf die Palme gebracht hätte: „Wie ich ein Todfeind
sey von allem Parodieren und Travestieren hab ich nie verhehlt”, schrieb
er, einer der Meistparodierten, 1824 an Zelter, und ähnlich erbitterte
Feinde des Gegengesangs werden sich auch heute finden lassen. Ungehalten
jedenfalls reagierte Dr. Siegfried Unseld, als während der Buchmesse
von 1980 auf gutgetürkten Flugblättern die Kollaboration seines
Suhrkamp Verlages mit der Großhandelskette Aldi bekanntgegeben und
das Verlagsprogramm der „edition sual” vorgestellt wurde. Jetzt kann man
den immer noch aktuellen, schönen Text der anonymen Verfasser wieder
nachlesen, da die Herausgeber der „Amme” sich weiserweise nicht auf Dichterparodien
beschränkt, sondern mit Erfolg auch angrenzendes Gelände, Wissenschaft,
Journalismus und Werbung, nach Parodiertem durchforstet haben.”
Zu Recht hebt hier Henscheid u. a.
auf außerliterarische Objekte der literarischen Parodie ab, die wir
tatsächlich in umfänglicher Weise zu recherchieren versucht haben.
Und so könnte ein weiteres Hauptkapitel einer derartigen Vorlesung
etwa lauten:
V. Die literarische
Parodie als Schreibweise und als Medium der Kritik außerliterarischer
Texte, Textsorten und Texter (wie Werbetexter, Rezensenten, Philosophen
etc.).
D. h. also: Die Bandbreite des Parodierens
und Travestierens wird erheblich größer – und doch den tatsächlichen
Möglichkeiten des Parodistischen/Travestierens noch immer nicht gerecht;
denn Parodieren und Travestieren vermögen sich auch außerhalb
des Literarischen und Sprachlichen zu realisieren, nämlich in der
bildenden Kunst, im Film, in der Musik usw. Und so könnte ein weiteres
Kapitel einer derartigen Vorlesung etwa lauten:
VI. Die Parodie
als Verfahren, d. h. als gemischt-mediale und nichtsprachliche Kritikform.
Ein entsprechender erster Versuch in
unserem „Kontrafaktur”-Buch läßt sichtbar werden, woran dabei
zu denken ist.41
c) Exkurs: Satirische Kontrafaktur
im 20. Jahrhundert: der „Struwwelhitler” als Beispiel
Gegen Ende der Vorlesung möchte
ich nochmals auf das didaktische Mittel des kontrastiven Vergleichs zurückgreifen,
und zwar hier des Vergleichs des bekanntesten deutschen Bilderbuches mit
seiner englischsprachigen Adaption und Verarbeitung.
Dr. Heinrich
Hoffmann (*1809 in Frankfurt, † 1894 in Frankfurt), Leiter der Frankfurter
Irrenanstalt von 1851 bis zu seiner Pensionierung 1888, ist bekanntlich
der Schöpfer des „Struwwelpeter” und „bösen Friedrich”, des „Suppen-Kaspar”
und „Zappel-Philipp”, also der Erfinder „lustiger Geschichten und drolliger
Bilder”. Das Bilderbuch ist 1845 erstmals erschienen, verfaßt und
gemalt von einem Reimerich Kinderlieb, uns geläufig in der Version
der 5. Auflage von 1847. Um die Entstehung des Bilderbuches ranken sich
natürlich die Alltagsmythen, an deren Genese Hoffmanns Lebenserinnerungen
nicht wenig beteiligt waren. Im Falle unseres Interesses müssen wir
uns darum nicht kümmern – dafür allerdings um eine andere Tatsache.
„Der Struwwelpeter” gedieh zum Best-
und Longseller; Zahlen: Schon 1876, 31 Jahre nach dem Erscheinen der Erstauflage
mit 1.500 Exemplaren, wurde die 100. Auflage erreicht; 1896 kam die 200.
Auflage heraus; nur jeweils 12 Jahre dauerte es bis zur 300. Auflage 1908
und zur 400. Auflage 1920. Im Jahre 1921 brachten es die Bildergeschichten
von der 400. bis zur 502. Auflage; 1939 zählte man bereits die 539.
Auflage: immer handelt es sich dabei um die Auflagen in den Originalverlagen
Rütten & Loening sowie Loewes, nicht um die vielen Nachdruckauflagen
nach Erlöschen der Schutzfrist für das Urheberrecht des „Struwwelpeter”
1925. Hinzu kommen noch die Auflagen in fast allen Kultursprachen. 1892
scheint beispielsweise schon die 40. englische Auflage vorgelegen zu haben.
Der englische Text dieser Ausgabe wurde in deutschen Oberschulen gelesen
– usw. usf. Ein kleines Detail sei am Rande erwähnt: die Nachdichtung
nämlich von Mark Twain, die der Autor nach seinem Berlin-Aufenthalt
im Winter 1891/92 angefertigt hat; während dieses Berlin-Aufenthaltes
hat Mark Twain den „Struwwelpeter” kennengelernt. Wie übrigens Dr.
Heinrich Hoffmann das sog. „Urmanuskript” des „Struwwelpeter” 1844 seinem
Kind zu Weihnachten geschenkt hat, so hat auch Mark Twain seine englische
Nachdichtung für die eigenen Töchter geschrieben und, wie eine
sich erinnert, eindrucksvoll vorgetragen.42Was
läßt sich aus dieser eindrucksvollen Bestseller- und Longseller-Story
schließen: Zunächst einmal dieses, daß die Bildergeschichten
offenkundig ein hohes „kommunikatives Potential” im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte
erworben haben, zum anderen dann auch, daß es geradezu zwanghaft
wirkt, sich des einfachen Strukturierungsmodelles zu versichern – und zwar
zu bestimmten Zwecken im Dienst anderer, zu den Bildergeschichten des Originals
relativ externer Anliegen und Interessen. Dafür nun eine Illustration.
Das Beispiel stammt aus der langen
Geschichte der „Struwwelpeter”-Aneignungen in England, und zwar soll es
hier das Beispiel sein des 1941 erschienenen englischen „Struwwelhitler”.43Es
handelt sich bei dieser Aneignung um eine satirische ‚Aktualisierung’ des
deutschen Kinderbuches (Hitler als ungezogenes und brutales Kind!) und
steht in einer langen Tradition karikaturistischer und satirischer Publizistik
in England, die die Bildergeschichte durchaus auch auf englische Verhältnisse
bezieht, um Kritik an denselben zu artikulieren. Der „Struwwelhitler” wendet
sich natürlich hier satirisch gegen Hitler selber und – in der Folge
der Bildergeschichten – auch gegen Repräsentanten des deutschen und
italienischen Faschismus. Auf dem Umschlag der Broschüre setzten die
Verfasser, Philipp und Robert Spence, übrigens das Pseudonym ‚Doktor
Schrecklichkeit’ ein.44Klar
dürfte dabei sein, daß sich die englische Adaption in ihrer
komisch-satirischen Verarbeitungsform nicht gegen die zugrundegelegte Vorlage
selbst richtet, sondern vielmehr die Vorlage für die Darstellung und
Kritik externer Sachverhalte benutzt und gebraucht (erneut sei schnell
angedeutet, daß wieder die Intentionsproblematik ins Spiel kommt).
Was macht aus diesem Sachverhalt eine
undifferenzierte Betrachtungsweise und Berichterstattung in der Publizistik?
Dazu das Beispiel:

Nürnberger
Nachrichten vom 19.01.1995
„PROPAGANDA
MIT STRUWWELHITLER
Figur wurde
oftmals satirisch verwendet – Zum Kämpfer für antiautoritäre
Erziehung stilisiert
Der Struwelpeter
hat Ende vergangenen Jahres seinen 150. Geburtstag gefeiert. Im Nürnberger
Spielzeugmuseum erinnert noch bis 26. Februar die Ausstellung „Sieh einmal,
hier steht er” an dieses wohl berühmteste deutsche Kinderbuch, das
von dem Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann geschrieben wurde. 25.000 Besucher
wurden allein in den ersten fünf Wochen der Präsentation gezählt.
Mit der spannenden,
aber weitgehend unbekannten politischen Dimension des Struwwelpeter befaßt
sich Dr. Walter Sauer aus Neckarsteinach nun am 26. Januar um 20 Uhr im
Foyer des Spielzeugmuseums, Karlstraße 13-15. Sein durch zahlreiche
Dias illustrierter Vortrag „Vom Struwwel-Hecker zum Struwwel-Hitler” stellt
die Parodien vor, die auf ein erwachsenes Publikum zielten.
Gerade in politisch
unruhigen Zeiten scheint der Struwwelpeter mit seiner neuen, ansprechend
gestalteten Verbindung von Text und Bild die Phantasie besonders angeregt
zu haben. An seiner Verwandlung in eine politische Figur ist Autor Hoffmann
nicht ganz unschuldig, denn im Revolutionsjahr 1848 – drei Jahre nach Drucklegung
des Struwwelpeter – schrieb er unter dem Pseudonym „Peter Struwwel” das
„Handbüchlein für Wühler”, das unter anderem Revolutionshelden
wie Friedrich Hecker satirisch aufs Korn nahm.
Seither wird
der Langmähnige mit Vorliebe in der literarischen Politsatire und
sogar in der internationalen Auseinandersetzung und Kriegspropaganda eingesetzt.
So erschienen im Ersten Weltkrieg entsprechende Parodien auf deutscher
wie auf englischer Seite: „Swollen-Headed William” (1914), „Kriegsstruwwelpeter”
(1915). Der Propaganda dienten auch im Zweiten Weltkrieg die Bücher
„Schicklgruber” oder „Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Dr. Schrecklichkeit”.
In der politischen
Umbruchsituation der späten sechziger Jahre wurde der Struwwelpeter
als Vorlage zeitgenössischer Satiren wiederentdeckt. Rainer und Eckhard
Hachfeld zogen 1969 den Berliner Bürgerschreck Rainer Langhans damit
durch den Kakao.”
Der die Abbildung umgebende Text zeigt
in der Tat nichts anderes als den historisch bekannten ‚Begriffssalat’,
bei dem ohne reflektierte Durchdringung eine terminologisch fundierte Bezeichnung
solcher Aneignungen nicht zustande kommen kann. Dieses letzte Beispiel
sollte noch einmal den Grundgedanken oder genauer einen der Grundgedanken
meiner Vorlesung repräsentieren können: Literaturwissenschaft
hat ihre Ausdrücke und Begriffe sorgfältig zu klären und
einzuführen. Ich hoffe, das ist mir zusammen mit Gunther Witting bei
einigen Schreibweisen-Begriffen gelungen.
d) Unmaßgebliche Schlussbemerkungen
Als ich turnusgemäß aufgefordert
war, die übliche Veranstaltungskommentierung abzuliefern, habe ich
mir einen harmlosen Scherz erlaubt mit Schillers Gedicht „Das Mädchen
von Orleans” von 1802 – mit seiner poetischen Apologie der „romantischen
Tragödie” gegen Voltaires ironisches Epos „La Pucelle d’Orléans”
von 1757. Den Scherz mit dem großen Klassiker trieb ich mittels einer
Lexemsubstitution bei den zum Geflügelten Wort verkommenen ersten
Versen der Schlußstrophe des Gedichts:
„Es liebt die
Welt, das Strahlende zu schwärzen
Und das Erhabne
in den Staub zu ziehn”.
Die von mir eingetauschte Variante
lautet im kommentierten Veranstaltungsverzeichnis:
„Es liebt die
Parodie, das Strahlende zu schwärzen
und das Erhabne
in den Staub zu ziehn”.
Sie dürfen in Zweifel ziehen,
ob die Parodie die Welt bedeutet.
Noch eine zweite Schlußbemerkung:
Ich kann mir vorstellen, daß Sie die nicht enden wollende Vorlesung
langsam leid sind. Halten Sie sich daher an ihr mit der „kürzesten
Parodie” in der Geschichte der literarischen Komik schadlos – mit der Parodie
auf Gottfried August Bürgers Schauerballade „Lenore”, die aus 32 Strophen
zu je acht Versen (also aus 256 Verszeilen) besteht und deren erste Strophe
lautet:
„Lenore fuhr
ums Morgenrot
Empor aus schweren
Träumen:
‚Bist untreu,
Wilhelm, oder tot?
Wie lange willst
du säumen?’
Er war mit König
Friedrichs Macht
Gezogen in die
Prager Schlacht,
Und hatte nicht
geschrieben,
Ob er gesund
geblieben.”
Bevor ich Sie nun mit den nächsten
31 Strophen bzw. 248 Versen bekannt mache, kürze ich das Wiedergänger-Geschehen
(und die Vorlesung) kurzerhand ab:
„Lenore fuhr
ums Morgenrot
Und als sie
rum war, war sie tot.”
1
Friedrich Theodor Vischer: Faust. Der Tragödie dritter Teil, Neudruck
der 2. Aufl. 1886 hrsg. v. Fritz Martini, Stuttgart 1978 (= RUB 6208).
2
Vgl. im übrigen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf: Aischylos. Interpretationen,
Berlin 1914.
3
Joris Duytschaever: Alfred Döblins Aischylos-Rezeption. Zur Funktion
der Orest-Parodie in "Berlin Alexanderplatz", in: Revue de littérature
comparée 53, 1979, S. 27-46.
4
Art. Bertolt Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe, in: Kindlers
neues Literatur-Lexikon, hrsg. v. Walter Jens, Studienausgabe, München
1996, Bd. 3, S. 92f., hier S. 93.
5
Uwe-K. Ketelsen: Kunst im Klassenkampf: "Die heilige Johanna der Schlachthöfe",
in: Walter Hinderer (Hrsg.): Brechts Dramen. Neue Interpretationen, Stuttgart
1984, S. 106-124, hier S. 114.
6
Ketelsen: Kunst im Klassenkampf, S. 114.
8
Karl-Wilhelm Frhr. v. Wintzingerode-Knorr: Hanns v. Gumppenbergs künstlerisches
Werk. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur der Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert, (Diss.) München 1958, S. 124.
9
Hanns von Gumppenberg: Lebenserinnerungen. Aus dem Nachlaß des Dichters,
Berlin/Zürich 1929, S. 125f.
13
Erwin Rotermund: Die Parodie in der modernen deutschen Lyrik, München
1963, S. 30ff.
14
Vgl. etwa Edgar Krausen: Art. "Hanns Theodor Karl Wilhelm Frhr. Von Gumppenberg",
in: Neue Deutsche Biographie 7, 1966, S. 311; Wolfgang Weismantel: Art.
"Gumppenberg, Hanns (Theodor Karl Wilhelm) Frhr. von", in: Walther Killy
(Hrsg.): Literatur Lexikon, Bd. 4, Gütersloh/München 1989, S.
426.
15
Vgl. Käte Lorenzen: Art. "Eichrodt, Ludwig", in: Neue Deutsche Biographie
4, 1959, S. 385.
16
Ludwig Eichrodt: Biedermaiers Liederlust. Lyrische Karikaturen, m. e. Nachw.
hrsg. v. Werner Kohlschmidt, Stuttgart 1981 (= RUB 7717), S. 9.
17
Eichrodt: Biedermaier, S. 158f.
18
Vgl. Walter Ruprechter: Art. "Mauthner, Fritz", in: Walther Killy (Hrsg.):
Literatur-Lexikon, Bd. 8, Gütersloh/München 1990, S. 20f. Dieser
Artikel ist hier weitgehend zugrundegelegt.
19
Gottfried Gabriel: Art. "Mauthner, Fritz", in: Jürgen Mittelstraß
(Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 2,
Mannheim u.a. 1984, S. 814f.
20
Fritz Mauthner: Nach berühmten Mustern. Parodistische Studien. Gesamtausgabe,
Stuttgart u.a. (Union Deutsche Verlagsgesellschaft) o.J. (1897), S. 5.
24
Vgl. Weismantel: Gumppenberg, S. 426.
25
Fundort: Erlangen, UB: Sch.L.A II, 4819 (Titelblatt beachten).
26
Vgl. das Ex. der UB München. Interessant ist das "Vorwort" von M.
G. Conrad, dem Vorsitzenden der "Gesellschaft für modernes Leben",
ebd. S. 2f., in dem auch versichert wird, Gumppenbergs "Vortrag" sei "mit
diplomatischer Treue nach dem Manuskript des Vortrages in der Isarlust
hergestellt" worden.
27
Das teutsche Dichterroß. In allen Gangarten vorgeritten von Hanns
von Gumppenberg. Mit e. Vorwort v. Armin Eichholz und e. Einleitung v.
Josef Hofmiller, München 1971 (= dtv 724); ferner: Hanns von Gumppenberg:
Das Teutsche Dichterroß. In allen Gangarten vorgeritten, hrsg. u.
m. Nachwort v. Robert Seidel, Heidelberg 1999: zugrunde liegt die 13. u.
14. Aufl. von 1929, vgl. auch das kluge Nachwort S. 174-202.
28
Hans Heinrich von Twardowski: Der rasende Pegasus. Zweite stark vermehrte
Ausgabe, Berlin (Axel Juncker Verlag) 1919, S. 15. (München, Bayer.
Staatsbibl.: D.D. I. 2674,1)
29
Peter Panter (= Kurt Tucholsky): "Neue Parodien von Hans Heinrich von Twardowski",
in: Die Weltbühne 14, 1919, Bd. 2, S. 558.
30
Kurt Tucholsky: "Der rasende Twardowski", in: ders.: Gesammelte Werke in
10 Bänden, hrsg. v. Mary Gerold-Tucholsky u. Fritz J. Raddatz, Reinbek
b. Hamburg 1975, Bd. 2: 1919-1920, S. 273.
31
Robert Neumann: Zur Ästhetik der Parodie, in: Die Literatur. Monatsschrift
für Literaturfreunde 30, 1927/28, S. 439-441; vgl. ders.: Die Parodien.
Gesamtausgabe, Wien u.a. 1962, S. 551-563.
32
Verweyen/Witting: Die Parodie, 1979, S. 77, 99, 156.
33
Franz-Heinrich Hackel: Zur Sprachkunst Friedrich Torbergs. Parodie – Witz
– Anekdote. Mit einem Anhang unbekannter Arbeiten aus der Frühzeit
Torbergs, Frankfurt/M. u.a. 1984.
34
Friedrich Torberg: PPP. Pamphlete, Parodien, Post Scripta, München
1964, S. 270.
35
Verweyen/Witting: Die Parodie, 1979, S. 85.
36
Vgl. Christian Schwarz: Art. "Eichholz, Armin", in: Walther Killy (Hrsg.):
Literatur Lexikon, Bd. 3, Gütersloh/München 1989, S. 203.
37
Vgl. Heino Freiberg: Art. "Buhl, Wolfgang", in: Killy, ebd., Bd. 2, 1989,
S. 313f.
38
Vgl. Christian Schwarz: Art. "Hoche, Karl", in: Killy, ebd., Bd. 5, 1990,
S. 371.
39
Vgl. Dirk Göttsche: Art. "Henscheid, (Hans-)Eckhard", in: Killy, ebd.,
Bd. 5, 1990, S. 217f.
40
Hans Mentze (Ps.): Humor-Kritik, Nr. 2: "Walpurga", in: Titanic 11, 1989,
Nr. 12 (Dezember), S. 48f.
41
Verweyen/Witting: Die Kontrafaktur, 1987, S. 126-170 und Bildanhang, S.
255-291.
42
Vgl. Dr. Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter. Englische Nachdichtung von
Mark Twain, Stuttgart 1994 (= RUB 8983), hier S. 69.
43
Zu dem „Struwwelpeter“-Komplex siehe Horst Künnemann u. Helmut Müller:
Art. „Hoffmann, Heinrich“, in: Klaus Doderer (Hrsg.), Lexikon der Kinder-
und Jugendliteratur in drei Bänden, Bd. 1, Weinheim 1975, S. 558-560;
Helmut Müller: Art. „Struwwelpeter, Struwwelpetriade“, in: Lexikon
der Kinder- und Jugendliteratur, Bd. 3, 1979, S. 483-488; Helmut Müller:
Art. „Struwwelpeter“ und Struwwelpetriaden, in: K. Doderer u. H. Müller
(Hrsg.), Das Bilderbuch. Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in
Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart, Weinheim 1973, S.
141-182.
44
Vgl. das Faksimile in: „Das war ein Vorspiel nur ...“. Bücherverbrennung
Deutschland 1933. Voraussetzungen und Folgen. Ausstellung der Akademie
der Künste vom 8. Mai bis 3. Juli 1983, Ausstellung und Katalog v.
Hermann Haarmann, Walter Huder u. Klaus Siebenhaar, Berlin/Wien 1983, S.
249, ferner S. 250f.
 Zum
Inhaltsverzeichnis
Zum
Inhaltsverzeichnis
 Zur
Bibliographie
Zur
Bibliographie
 Zum
Ede-Hauptverzeichnis
Zum
Ede-Hauptverzeichnis